| Buchhandlung Heesen | Versandbuchhandlung für Evangelische Theologie |
Impressum | |
| Freudenstadt / Loßburg | Datenschutzhinweise | ||
| Tel. 07446 952 418 1 | Buchhandlung.Heesen@t-online.de | ||
| Da unsere Angebote manuell erstellt werden und während des Seitenaufrufes keine Verbindung zu einer Buchdatenbank aufgebaut wird prüfen wir die Verkaufspreise bei Rechnungsstellung auf Richtigkeit und berechnen den gesetzlich festgelegten Buchpreis. Falls sich dadurch eine Preiserhöhung ergibt werden wir Sie vor Versand informieren, Sie können dann diesem Preis zustimmen oder vom Kauf zurücktreten. Hinweise zum Datenschutz und Cookies | |||
|
Karl
Barth, Die kirchliche Dogmatik / zur
Erklärung |
||||||||||
|
Originalausgabe 14 Bände vergriffen,nicht mehr lieferbar Leinenausgabe |
Studienausgabe 31 Bände,
kartoniert, Schriftgröße und -bild identisch mit Leinenausgabe Komplettausgabe: 978-3-290-11634-7, 495,00 EUR |
|||||||||
 |
§ | 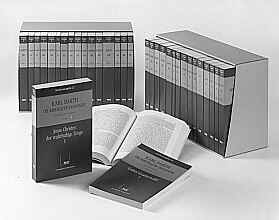 Komplettausgabe: 495,00 EUR |
EUR
bei Einzel- abnahme |
§ | ||||||
|
1 | 1. Halbband (I,1) | 1-12 | 1 | 3-290-11601-8 | 978-3-290-11601-9 | Das Wort Gottes als Kriterium der Dogmatik | 32,00 |
|
1-7 |
| 2 | 3-290-11602-6 | 978-3-290-11602-6 | Die Offenbarung
Gottes 1. Abschnitt: Der dreieinige Gott zur Beschreibung |
20,00 |
|
8-12 | ||||
| 2 | 2. Halbband (I,2) | 13-24 | 3 | 3-290-11603-4 | 978-3-290-11603-3 | Die Offenbarung
Gottes 2. Abschnitt: Die Fleischwerdung des Wortes |
25,00 |
|
13-15 | |
| 4 | 3-290-11604-2 | 978-3-290-11604-0 | Die Offenbarung
Gottes 3. Abschnitt: Die Ausgiessung des Heiligen Geistes |
29,00 |
|
16-18 | ||||
| 5 | 3-290-11605-0 | 978-3-290-11605-7 | Die Heilige Schrift | 29,00 |
|
19-21 | ||||
| 6 | 3-290-11606-9 | 978-3-290-11606-4 | Die Verkündigung der Kirche | 20,00 |
|
22-24 | ||||
|
3 | 1. Halbband (II,1) | 25-31 | 7 | 3-290-11607-7 | 978-3-290-11607-1 | Die Erkenntnis Gottes | 29,00 |
|
25-27 |
| 8 | 3-290-11608-5 | 978-3-290-11608-8 | Die Wirklichkeit Gottes 1. Teil | 20,00 |
|
28-30 | ||||
| 9 | 3-290-11609-3 | 978-3-290-11609-5 | Die Wirklichkeit Gottes 2. Teil | 29,00 |
|
31 | ||||
| 4 | 2. Halbband (II,2) | 32-39 | 10 | 3-290-11610-7 | 978-3-290-11610-1 | Gottes Gnadenwahl 1. Teil | 25,00 |
|
32/33 | |
| 11 | 3-290-11611-5 | 978-3-290-11611-8 | Gottes Gnadenwahl 2.Teil | 32,00 |
|
34/35 | ||||
| 12 | 3-290-11612-3 | 978-3-290-11612-5 | Gottes Gebot | 29,00 |
|
36-39 | ||||
|
Dritter
Band: Die Lehre von der Schöpfung zu Gen 1-11 zu Paragraph 50 ist lieferbar: Gott und das Nichtige 978-3-290-17409-5 |
5 | 1. Teil (III,1) | 40-42 | 13 | 3-290-11613-1 | 978-3-290-11613-2 | Das Werk der Schöpfung | 38,00 |
|
40-41 |
| 6 | 2. Teil (III,2) | 43-47 | 14 | 3-290-11614-X | 978-3-290-11614-9 | Das Geschöpf 1. Teil | 25,00 |
|
43/44 | |
| 15 | 3-290-11615-8 | 978-3-290-11615-6 | Das Geschöpf 2. Teil | 29,00 |
|
45/46 | ||||
| 16 | 3-290-11616-6 | 978-3-290-11616-3 | Das Geschöpf 3. Teil | 25,00 |
|
47 | ||||
| 7 | 3. Teil (III,3) |
48-51 |
17 | 3-290-11617-X | 978-3-290-11617-0 | Der Schöpfer und sein Geschöpf 1. Teil | 29,00 |
|
48/49 | |
| 18 | 3-290-11618-2 | 978-3-290-11618-7 | Der Schöpfer und sein Geschöpf 2. Teil | 29,00 |
|
50/51 | ||||
| 8 | 4. Teil (III,4) | 52,56 | 19 | 3-290-11619-0 | 978-3-290-11619-4 | Das Gebot Gottes des Schöpfers 1. Teil | 38,00 |
|
52-54 | |
| 20 | 3-290-11620-4 | 978-3-290-11620-0 | Das Gebot Gottes des Schöpfers 2. Teil | 38,00 |
|
55/56 | ||||
|
9 | 1. Teil (IV,1) | 57-63 | 21 | 3-290-11621-2 | 978-3-290-11621-7 | Der Gegenstand und die Probleme der Versöhnungslehre. Jesus Christus der Herr als Knecht. 1. Teil | 38,00 |
|
57-59 |
| 22 | 3-290-11622-0 | 978-3-290-11622-4 | Jesus Christus der Herr als Knecht 2. Teil | 25,00 |
|
60 | ||||
| 23 | 3-290-11623-9 | 978-3-290-11623-1 | Jesus Christus der Herr als Knecht 3. Teil | 29,00 |
|
61-63 | ||||
| 10 | 2. Teil (IV,2) | 64-68 | 24 | 3-290-11624-7 | 978-3-290-11624-8 | Jesus Christus der Knecht als Herr 1.Teil | 38,00 |
|
64 | |
| 25 | 3-290-11625-5 | 978-3-290-11625-5 | Jesus Christus der Knecht als Herr 2.Teil | 29,00 |
|
65/66 | ||||
| 26 | 3-290-11626-3 | 978-3-290-11626-2 | Jesus Christus der Knecht als Herr 3.Teil | 29,00 |
|
67/68 | ||||
| 11 | 3. Teil (IV,3) | 1. Hälfte: 69/70 | 27 | 3-290-11627-1 | 978-3-290-11627-9 | Jesus Christus der wahrhaftige Zeuge 1.Teil | 38,00 |
|
69 | |
| 12 | 2. Hälfte: 71-73 | 28 | 3-290-11628-X | 978-3-290-11628-6 | Jesus Christus der wahrhaftige Zeuge 2.Teil | 32,00 |
|
70/71 | ||
| 29 | 3-290-11629-8 | 978-3-290-11629-3 | Jesus Christus der wahrhaftige Zeuge 3.Teil | 29,00 |
|
72-73 | ||||
| 13 | 4. Teil (IV,4) | chr. Leben (Fragment) Taufe |
30 | 3-290-11630-1 | 978-3-290-11630-9 | Das christliche Leben (Fragment) Die Lehre von der Versöhnung. Die Taufe als Begründung des christlichen Lebens | 29,00 |
|
||
| 14 | Register | 31 | 3-290-11633-6 | 978-3-290-11633-0 | Registerband | 59,00 |
|
|||
|
Unveröffentlichte Texte zur Kirchlichen Dogmatik
Supplemente zur Karl-Barth-Gesamtausgabe |
||||||||||
 |
Karl
Barth Die Offenbarung Gottes 1 Der dreieinige Gott Theologischer Verlag Zürich, 1987, 236 Seiten, kartoniert, 978-3-290-11602-6 20,00 EUR |
Kirchliche Dogmatik Studienausgabe Band 2 zur Seite Dreieinigkeit / Trinität |
|
| INHALT ZWEITES KAPITEL. DIE OFFENBARUNG GOTTES Erster Abschnitt. Der dreieinige Gott § 8 Gott in seiner Offenbarung 311 Die Stellung der Trinitätslehre in der Dogmatik 311 Die Wurzel der Trinitätslehre 320 Das vestigium trinitatis 352 § 9 Gottes Dreieinigkeit 367 Die Einheit in der Dreiheit 367 Die Dreiheit in der Einheit 373 Die Dreieinigkeit 388 Der Sinn der Trinitätslehre 395 |
§ 10 Gott der Vater 404 Gott als Schöpfer 404 Der ewige Vater 411 § 11 Gott der Sohn 419 Gott als Versöhner 419 Der ewige Sohn 435 § 12 Gott der heilige Geist 470 Gott der Erlöser 470 Der ewige Geist 489 Übersetzung der fremdsprachlichen Zitate Anhang 1 Register I. Bibelstellen Anhang 27 11. Namen Anhang 29 Ill. Begriffe Anhang 30 |
||
 |
Matthias D. Wüthrich Gott und das Nichtige Theologischer Verlag Zürich, 2006, 400 Seiten, Paperback, 978-3-290-17409-5 58,00 EUR |
siehe dazu
Kirchliche Dogmatik Studienausgabe Band 18 Eine Untersuchung zur Rede vom Nichtigen ausgehend von Paragraph 50 der Kirchlichen Dogmatik Karl Barths Wie kann und soll vom Bösen gesprochen werden? Die gegenwärtig vielfältig konstatierte Sprachnot in der Rede vom Bösen betrifft nicht nur ihren Inhalt, sondern auch ihren Redemodus. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg verfasst Karl Barth im Rahmen seiner 'Kirchlichen Dogmatik' einen Paragraphen, den er mit 'Gott und das Nichtige' überschreibt. Barth nimmt sich darin in äusserst pointierter und bedenkenswerter Weise jener Sprachnot in der Rede vom Bösen an. Er transformiert dabei an wesentlichen Punkten theologische und philosophische Denktraditionen in der Rede vom Bösen. Die vorliegende Untersuchung nimmt diesen Paragraphen zum Ausgangspunkt einer gründlichen Analyse von Barths Rede vom Nichtigen. Verhandelt werden u. a. Genese, Phänomengehalt, Funktion und Redemodus der Rede vom Nichtigen. Die Untersuchung schliesst mit dem Versuch einer kritischen Weiterführung von Barths Rede vom Nichtigen mittels einer systematisch-theologischen Besinnung auf Inhalt und Redemodus der Klage. |
|
 |
Juliane Schüz Glaube in Karl Barths Kirchlicher Dogmatik Die anthropologische Gestalt des Glaubens zwischen Exzentrizität und Deutung De Gruyter, 2018, 426 Seiten, 747 g, Gebunden, 978-3-11-056759-5 119,95 EUR |
Theologische
Bibliothek Töpelmann Band 182 In dieser Studie wird zum ersten Mal eine systematische Analyse des menschlichen Glaubens in Karl Barths Kirchlicher Dogmatik vorgelegt. Barths Theologie wurde häufig vorgeworfen, dass sie diesen Topos marginalisiere. Demgegenüber weist Juliane Schüz die zentrale Rolle des Glaubens in Barths dogmatischer Methodologie sowie in dessen eigentümlicher Verschränkung von Christologie und Anthropologie nach. So wird im Querschnitt durch Barths Dogmatik ein vielseitiges Bild des Glaubensvollzugs gezeichnet. Einerseits birgt der Glaube als menschliche Tat die irreduzible Dimension von Geschichtlichkeit und Freiheit sowie die Möglichkeit seiner Verkehrung in der "Religion". Andererseits ist der Glaube ebenso göttliche Tat ‚extra nos‘ und nur ‚analogisch‘ als eine dem Menschen zukommende Partizipation in Christus zu verstehen. Die Studie zeigt unter Aufnahme der dialektischen Grundentscheidung Barths, wie Barth die ‚exzentrische‘ Konstitution und Bestimmung des Glaubens mit dessen aktiver, subjektiver Aneignung durch Deutungen vermittelt. In der Weiterführung der Barthschen Konzeption entwickelt Schüz eine jenseits der etablierten Alternativen stehende, neue Perspektive in der religionsphilosophischen Debatte um den Deutungsbegriff. Bllick ins Buch |
|
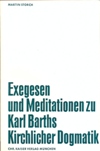 |
Martin Storch Exegesen und Meditationen zu Karl Barths Kirchlicher Dogmatik Chr. Kaiser Verlag, 1964, 126 Seiten, kartoniert, 4,90 EUR |
Beiträge zur evangelischen Theologie Band 36 In dieser Untersuchung werden Hauptthemen aus der kirchl. Dogmatik mit der jeweiligen theologischen Diskussion unserer Tage konfrontiert. Sie erwuchs aus Vorlesungen am Predigerseminar der Hannoverschen Landeskirche. |
|
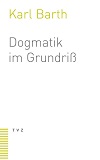 |
Karl Barth Dogmatik im Grundriß Theologischer Verlag Zürich, 2020, 192 Seiten, Broschur, 978-3-290-11030-7 15,00 EUR |
mit einem Nachwort von Hinrich Stoevesandt Barth hat den Bonner Studenten im Sommersemester 1946 anhand des Apostolischen Glaubensbekenntnisses einen Grundriss evangelischer Glaubenslehre geboten. Er zeigt, was ein echter Exeget aus dem Apostolikum herauszuholen vermag: nicht weniger als das tragende Gerüst, als das Fundament der ganzen christlichen Dogmatik überhaupt. |
|
 |
Walter Kreck Grundentscheidungen in Karl Barths Dogmatik Neukirchener Verlag, 1978, 320 Seiten, Kartoniert, 3-7887-0550-7 978-3-7887-0550-3 16,00 EUR |
Neukirchener Studienbücher Band 11 Zur Diskussion seines Verständnisses von Offenbarung und Erwählung |
|
|
Die
Kirchliche Dogmatik Karl Barth (1932–1968)
|
| Barth begann in betontem Kontrast
zu Schleiermacher mit einer Lehre vom Wort Gottes, die
zugleich Trinitätslehre ist (KD I/1, 1932). Er
entfaltete Anselms Satz „Gott kann nur durch Gott
erkannt werden“ nun trinitarisch: Jesus Christus
allein ist Gottes Selbstoffenbarung mitten in der Zeit.
Daher kann Gott, der Vater und Schöpfer, nur von Gott,
dem Sohn, durch den Heiligen Geist als der Gott erkannt
werden, der seine Welt mit sich versöhnt und so unsere
Gotteserkenntnis schafft. Während die katholische und lutherisch-orthodoxe Dogmatik allgemeine (natürliche) und spezielle (christologische) Offenbarung Gottes auftrennte, setzte Barth sie in eins: Indem Gott in Christus sein Wesen als der Dreieinige offenbart, schafft er die Möglichkeit der Gotteserkenntnis, die uns von Natur aus schlechthin unmöglich ist und bleibt. Nur weil Gott dieser höchst besondere, in sich selbst lebendige Gott ist, kann er sich als der offenbaren, der er ist. Wie wir ihn erkennen und was er für uns ist (dogmatisch formuliert: „ökonomische“ und „immanente“ Trinität), fallen daher – von Gott, nicht vom Menschen her! – zusammen. Man hat Barth „Offenbarungspositivismus“ vorgeworfen, weil er Gottes Dasein und Sosein mit nichts als Gott selbst begründete, also keinem Ober- und Außenbegriff unterwarf. Dabei wird meist verkannt, dass er implizit bereits das Geschehen von Kreuz und Auferweckung voraussetzte, das er später differenziert entfaltete. Er betonte eine streng christozentrische Erkenntnistheorie: Alle theologischen Aussagen müssen sich am Christusereignis messen lassen und von daher bestimmt werden. Die die Theologiegeschichte beherrschende analogia entis (Ontologie) wird transformiert in eine analogia fidei : Glaube an Jesus Christus als einzigen Gott ist das scharfe Gegenteil von Religion, die Gott „eigenmächtig“ mit uns zu versöhnen sucht. Der berühmte Paragraph 17 von KD I/2 (1937) fasst Barths Religionskritik an der über 1700jährigen Fehlentwicklung des Christentums, die im Versagen gegenüber der Hitlerdiktatur unübersehbar wurde, in den Satz zusammen: Religion ist Unglaube. Denn nur Gott selbst kann von Gott reden. Seine Souveränität, die „von oben“ in die heillos in-sich-verschlossene Selbstrechtfertigung und Bilderfabrik des Menschen einbricht, blieb das Leitmotiv. Aber Gott hat in der Geschichte Jesu Christi schon sein endgültiges Ja-Wort zum Menschen gesprochen: Im Licht dieser exklusiven Rechtfertigungstat ist diese unerlöste Welt doch schon mit Gott versöhnt. Indem das unausweichliche Gericht des Kreuzes die vom religiösen Menschen produzierten Nicht-Götter als Verleugnung Gottes aufdeckt, dient es der Befreiung aus den gottlosen Bindungen dieser Welt zum freien und frohen Dienst an Gottes Geschöpfen (Barmer These I). Davon ausgehend begann Barth, die Aufgabe der Kirche in der Welt völlig neu zu bestimmen. Sowenig wie Christus- und Gotteserkenntnis lassen sich Dogmatik und Ethik bei ihm trennen. Er kehrte die lutherische Folge von „Gesetz und Evangelium“ um zu Evangelium und Gebot und suchte die verbindende Analogie von Rechtfertigung und Recht in der alleinigen Christusherrschaft. Damit begründete er das politische Widerstandsrecht der Christen gegen einen totalen Staat, der die Menschenrechte mit Füßen tritt. 1940 erschien der erste Band der Gotteslehre (KD II/1), 1942 erschien dann mit der Lehre von Gottes Gnadenwahl der zweite Band (KD II/2). Diese ist der eigentliche Kern des riesigen Gedankengebäudes der KD, das sich „wie Kreise um einen ins Wasser geworfenen Stein“ konzentrisch ausbreitete. Die Vorrangstellung der Prädestination als Auslegung der Inkarnation zeigte sich schon in KD I an Barths betont „realistischer“ Lehre von der Jungfrauengeburt Jesu Christi, in der – höchst ungewöhnlich in der protestantischen Theologie! – Maria zu vollen Ehren kam. Jeder menschliche Zugriff auf das Wunder der Offenbarung ist ausgeschlossen: Es handelt sich dabei nur um die Durchführung des in Ewigkeit Beschlossenen. Dies entfaltete er nun aber ganz vom „ungekündigten Bund“ (Martin Buber) mit Israel her. Der Ruf zur unbedingten kirchlichen Solidarität mit dem Judentum wurde sein Vermächtnis an die Ökumene, deren theologischer Berater er seit 1948 war. 1951–1954 folgte die Schöpfungslehre (KD III): So wie die Schöpfung der „äußere Grund des Bundes“ Gottes mit Israel – und darin eingeschlossen der Menschheit – ist, so ist Gottes eigene Bundeserfüllung in Christus der „innere Grund der Schöpfung“. Dies begründete Barths nun immer stärkere Hinwendung zur Welt, die nicht aus sich heraus gut werden kann, aber von vornherein gerechtfertigt und begnadigt als gute Welt erkannt und gestaltet werden kann. Hier entwarf er auch eine Anthropologie des Dialogs, in der er sowohl Bonhoeffers Ethik des „Menschseins für Andere“ als auch Martin Bubers dialogische Anthropologie (Ich und Du) aufgriff. In seiner Versöhnungslehre (KD IV, 1956–59) wagte Barth nochmals einen Neuansatz auch gegenüber KD I/1. Er nahm nun Martin Luthers theologia crucis voll auf und integrierte sie in Johannes Calvins übergreifenden, vom Alten Testament bestimmten Bundesbegriff: In der tiefsten Erniedrigung des Gottessohnes, nämlich in seinem Tod am Kreuz, offenbart Gott indirekt sein wahres Gottsein. Zugleich geschieht mit der endgültigen Erhöhung des Menschensohns (Barth verwendet diesen Hoheitstitel hier inklusiv!) die unüberbietbare Rechtfertigung und Heiligung unseres Menschseins: In dieser Doppelbewegung, die nur von Gott selbst her erkannt werden kann, vollzieht sich die Versöhnung. Sie ist für Barth der Oberbegriff, in den er Freiheit und Gerechtigkeit integrierte. Damit erfährt Menschenwürde ihre eigentliche Begründung, die von keiner empirischen und historischen Erfahrung ableitbar und überholbar ist. Damit verlegte Barth den Akzent vom richtenden hin zum gnädigen Gott: im bewussten Kontrast zu den gnadenlosen Kreuzzugsideologien von West und Ost, die die Menschheit im Kalten Krieg an den Abgrund führten. Die Menschlichkeit Gottes (Aufsatztitel) ersetzt sein unnahbares Gottsein aber nicht, sondern erfüllt dieses allererst. Gerade in der Gottverlassenheit des Gekreuzigten ist der „Ganz Andere“, der weltlose Ungreifbare, uns ganz nah, und gerade so ist er ganz Gott: Gottes Allmacht ist seine Fähigkeit zur Ohnmacht, die er mit uns teilt. Dies kann nur von Gott selbst, nämlich durch den Geist des Auferweckten erkannt werden, der die im Kreuz verborgene Versöhnung der Welt in Kraft setzt. Barths Sündenlehre definiert Sünde als das Nichtige, schlechthin von Gott Verworfene: Was das Böse und wie gefährlich es für alles Leben eigentlich ist, kann wiederum nur von seiner Überwindung im Kreuz Jesu Christi her erkannt werden. Indem Gott in Christus das Böse erleidet und daran stirbt, verneint er es endgültig, entzieht er ihm schon seinen Existenzgrund, entmachtet er schon seine scheinbar totale Weltherrschaft. Darum konnte Barth in einer „Abschreckung“ mit Massenvernichtungsmitteln nur den Teufel am Werk sehen, mit dem der Mensch keine Kompromisse eingehen kann, ohne letztlich zu unterliegen. Widerstand dagegen mit allen verfügbaren, d.h. christlich möglichen Mitteln war sein geradezu befehlender Ruf an die Völker aller Länder, noch bevor Albert Schweitzer 1958 zum Stopp aller Atomtests aufrief. Die Trinitätslehre, die am Anfang der KD stand, wird nun nochmals hinsichtlich des Weltbezugs entfaltet: Jesus Christus als sein eigener Prophet deckt das Kommen Gottes zur Welt, die Revolution dieser Welt, ihr Ende und ihr Neuwerden auf. Seine Königsherrschaft ist bereits insofern wirksam, als sie uns zum Entdecken von „Lichtern“, Analogien zu seinem Reich in der Welt befähigt (KD IV/3, § 69): Dazu gehörte für Barth der demokratische Rechtsstaat (Christengemeinde und Bürgergemeinde) ebenso wie der Sozialismus und Marxismus (Darmstädter Wort), aber auch die Begegnung und der Dialog mit den Religionen, allen voran dem Judentum, zur gemeinsamen Bewahrung der Schöpfung (Ad limina Apostolorum). |